Lehrveranstaltungen Lampe, Filmanalyse
NarraTion
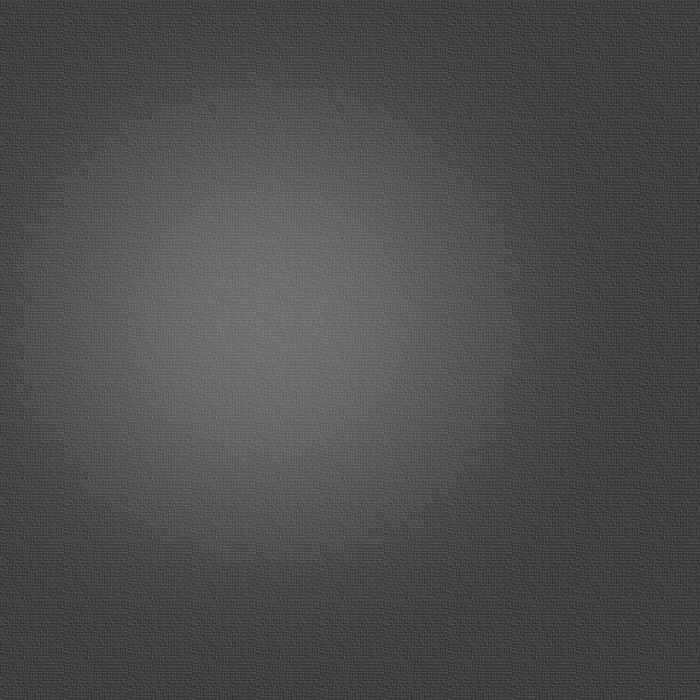
Lehrveranstaltungen Lampe, Filmanalyse
NarraTion
Die Begriffe werden in der kognitiven Filmtheorie gebraucht. Story und plot weisen fundamentale Unterscheide auf.
Plot ist die Bezeichnung aller visuellen und auditiven Elemente, die ein Film- (oder Fernsehstück) präsentiert. Story bezeichnet die zeitlich-lineare und kausal verknüpfte Kette von Ereignissen und handelnden Personen. Die Unterschiede liegen hauptsächlich darin, dass der Zuschauer die Kette von plots zu stories zusammensetzt. Mit anderen Worten: Was auf der Leinwand zu sehen und durch die Lautsprecher zu hören ist, ist längst nicht der ganze Film. Der Zuschauer ergänzt, muss ergänzen, weil alle Filme auf dieses tätige Moment setzen, wenn sie nicht langweilen wollen.
Weshalb ist die Unterscheidung zwischen Plot und Story wichtig? Der Medienwissenschaftler Lothar Mikos formuliert folgendermaßen:
„Weil Geschichten auf verschiedene Arten erzählt werden, die verschiedene Möglichkeiten der Publikumspartizipation erlauben. Die Beteiligung des Publikums bringt erst die Story hervor, die aus den zum Plot gehörenden abgebildeten Ereignissen besteht. Das Publikum muss aktiv Zusammenhänge herstellen“ (Lothar Mikos, Film- und Fernsehanalyse. Konstanz 2003, S. 129).
Weiter heißt es:
„Die Ordnung des Plots wird von der Dramaturgie geliefert. Sie bestimmt die Reihenfolge der präsentierten Ereignisse und legt fest, wann so genannte Plotpoints der Handlung eine entscheidende Wendung geben, durch die die Figuren in ihrer Entwicklung entscheidend beeinflusst werden. Plotpoints sorgen für neue Perspektiven auf die Ereignisse und die Figuren und sind besonders beliebt, um den Helden neue Ereignisse in den Weg zu legen oder am Ende des Films doch noch eine überraschende Lösung zu verheißen“ (ebd., S. 129).
„Die Dramaturgie zielt darauf ab, im Plot Hinweise zu geben, aus und mit denen die Zuschauer kognitiv und emotional die Geschichte produzieren. Das spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn es Auslassungen oder Leerstellen im Plot gibt“ (ebd., S. 131).
Story und Plot – fundamentale Unterschiede
Am Beispiel von Garry Marshals Pretty Woman (USA 1990)
Diese „elliptische Erzählweise“ funktioniert so, dass der plot anhält, die story aber (im Kopf des Zuschauers) weitergeht. Mikos erwähnt ein sehr treffendes Beispiel: das der angeblichen „Fellatio“ in Pretty Woman (USA 1990, Regie: Garry Marshall; Richard Gere als Edward Lewis, Julia Roberts als Vivian Ward). Der Broker Edward hat die Prostituierte Vivian mit in sein Hotelzimmer genommen. Edward sitzt in einem Sessel; Vivian, die bereits nur noch ihre Dessous trägt, kniet vor ihm und öffnet nach und nach seine Kleidung. In den letzten Einstellungen der Szene ist zu sehen, wie sie mit ihrem Gesicht langsam am Körper von Edward hinuntergleitet, der anschließend mit geschlossenen Augen den Kopf zurücklehnt. In der nächsten Einstellung wird Edward unter der Dusche gezeigt. Mikos:
„Aus dem Arrangement der Plots können die Zuschauer schließen, dass die beiden Sex miteinander hatten – zu sehen war das aber nicht“ (ebd., S. 131).
Mikos führt anschießend als Beispiel für eine story-Bildung an, dass die amerikanische Filmwissenschaftlerin Jane Caputi in einem Aufsatz aus dem Jahre 1991 diesen Teil des Plots zu dieser Story konstruiert, wenn sie schreibt: „als sie über ihn kriecht, um Fellatio auszuüben“ (zit. nach Mikos, ebd. S. 131).
Der folgende Ausschnitt (3:00) ist insofern verwirrend, dass Vivian ein TV-Stück sieht. Dies ist offensichtlich dazu angetan, den Zuschauer in seiner story-Bildung anzuregen und symbolisch aufs erotische Feld zu führen. Am Ende hat auch die tropfende Dusche womöglich tiefenpsychlogische Bedeutung. Aber mit solchen Deutungen begibt man sich selbst rasch aufs Glatteis einer neuerlichen Storykonstruktion.